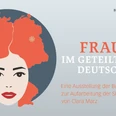Stell dir vor, es ist das Jahr 1883. In Wolfenbüttel wird eine neue Synagoge gebaut. Sie ist ein großes, schönes Gebäude mit hohen Fenstern und einem hellen Raum für Gebete. Hier finden 200 Männer und 84 Frauen auf der Empore Platz.
Für die jüdische Gemeinde ist das ein ganz besonderer Moment. Es sind viele Gäste da, wie z.B. Bürger nicht jüdischen Glaubens oder Vertreter des Stadtmagistrats. Die Synagoge wird ihr Treffpunkt – ein Ort für Gebete, Feste und Zusammenhalt.
Ein jüdischer Gottesdienst beginnt meist mit dem gemeinsamen Gebet. Männer und Frauen sitzen getrennt, die Männer tragen Kippas, manche auch Tallit, Gebetsschals. Der Rabbiner oder Vorbeter führt die Gemeinde durch den Gottesdienst. Die Torahrolle, sorgfältig von Hand geschrieben, wird aus dem Heiligen Schrein genommen und feierlich vorgetragen. Es ist ein Moment der Besinnung und des Glaubens – der Mittelpunkt des jüdischen Lebens.
Doch dieses Zentrum sollte nicht von Dauer sein. Bis zur Nacht des 9. November 1938.
In dieser Nacht, der sogenannten „Reichspogromnacht“, gibt es Gewalt gegen jüdische Menschen in ganz Deutschland. Viele Synagogen werden zerstört. Auch die Synagoge in der Lessingstraße bleib nicht verschont. Nazis stürmen hinein, zerbrechen die Fenster und Möbel und legen Feuer. Die Feuerwehr steht bereit, doch sie hat den strikten Befehl, nur einzugreifen, falls die Flammen auf benachbarte, nicht-jüdische Gebäude übergreifen sollten sowie auf Sonderanforderung der SS.
Die Flammen fressen sich durch das Holz, durch die Bänke, durch die Torahrollen – heilige Schriften, die Hunderte von Jahren alt waren. Für die jüdische Gemeinde ist es mehr als der Verlust eines Gebäudes. Es ist der Verlust eines Heims. Von der Wolfenbütteler Synagoge bleiben nur noch Teile der Umfassungsmauer.
Nach der Zerstörung der Synagoge im November 1938 blieb nur Schutt und Asche zurück. Die Nationalsozialisten haben nicht nur ein Gebäude verbrannt. Sie wollten auch das Leben und die Kultur der jüdischen Gemeinde in Wolfenbüttel zerstören. In jener Nacht werden alle jüdischen Männer der Gemeinde festgenommen und nach Buchenwald deportiert. Die Synagoge war ein besonderer Ort. Ein Ort für Gebete, Treffen und Hoffnung.
Doch damit endete der Schrecken für die jüdische Gemeinde in Wolfenbüttel nicht. Fritz Ramien, der nationalsozialistische Bürgermeister von Wolfenbüttel, richtet eine perfide Forderung an die jüdische Gemeinde Wolfenbüttels. Ramien fordert von den verbliebenen Mitgliedern der Juden, die Überreste ihrer Synagoge abzutragen oder sie müssten alle entstehenden Kosten des Abrisses tragen. Die Gefährdung der Passanten wäre zu groß, um die Mauern weiter bestehen zu lassen. Letztendlich war diese nur der Anfang vom Ende der Demütigung und Zerstörung der jüdischen Gemeinde in Wolfenbüttel.
Eine virtuelle Rekonstruktion ist online oder im Bürger Museum zu sehen.
Gut zu wissen
Öffnungszeiten
Eignung
für Schulklassen
für Familien
für Individualgäste
Haustiere erlaubt
für Kinder (ab 10 Jahre)
Zahlungsmöglichkeiten
Ansprechpartner:in
Stadt Wolfenbüttel - Abteilung Tourismus
Autor:in
Lessingstadt Wolfenbüttel
Organisation
Lessingstadt Wolfenbüttel
Lizenz (Stammdaten)
Unsere Empfehlung
In der Nähe